
Die Kraft eines Bildes
Da formte Gott, der HERR, den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann pflanzte Gott, der HERR, in Eden, im Osten, einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. – Genesis 2,7-8
„Gott pflanzte einen Garten“ (Gen 2,8) – kaum ein anderer Satz der Bibel ruft ein so starkes inneres Bild hervor. Nicht eine Stadt, nicht ein Tempel, nicht ein Klassenzimmer oder Lehrsaal – ein Garten war der erste Ort, den die Bibel beschreibt, nachdem der Mensch geschaffen wurde. Ein Garten ist kein Zufallsprodukt. Er entsteht nicht einfach so, schon gar nicht in biblischer Zeit. Ein Garten ist ein gestalteter Raum – mit dem Ziel, Leben zu ermöglichen und zur Entfaltung zu bringen. In der jüdisch-christlichen Tradition ist der Garten Eden deshalb mehr als ein romantisches Bild: Er ist ein Entwurf von einem gelingenden Lebens- und Lernraum. Und genau darin liegt seine überraschende Aktualität – besonders für die Pädagogik unserer Zeit, die sich zunehmend der Bedeutung des Raumes und der Haltung der Gestaltenden bewusst wird.
Der Garten als theologische Raumvision
In der biblischen Erzählung ist der Garten Eden der erste Bildungsraum des Menschen. Er ist von Anfang an als ein Ort gedacht, in dem der Mensch wachsen, entdecken, benennen und Verantwortung übernehmen kann. Der Mensch lebt dort nicht im Stillstand, sondern ist in Bewegung: Er soll den Garten bebauen und bewahren (Gen 2,15). Diese Aufforderung zur aktiven Gestaltung und zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Gegebenen ist auch für Pädagogen*innen zentral.
Raum ist hier nicht nur ein Ort des Geborgenseins, sondern auch ein Ort des Übergangs und der Reifung.
Die große Freiheit, die dem Menschen dabei zugestanden wird, wird nur von der Verantwortung gegenüber diesem Raum und seinen Möglichkeiten begrenzt. Dieser Raum will nicht besitzen, sondern ermöglichen. Kein Zwang, kein System, sondern ein Beziehungsraum – mit Gott und sich selbst. Auch die zwar sehr bekannte, aber oft missinterpretierte Erzählung vom Baum der Erkenntnis lässt sich pädagogisch deuten: Sie beschreibt nicht nur ein Verbot, sondern markiert den Übergang des Menschen vom kindlichen Zustand hin zu reifer Eigenverantwortung.
Die fehlende Scham über die Nacktheit (Kindheit), das Zuschieben der Schuld auf andere (Pubertät), das Verlassen des Gartens (Erwachsenwerden) – all das sind klassische Merkmale einer Coming-of-Age-Erzählung. Der Mensch soll nicht ewig Kind bleiben, sondern sich entwickeln, selbst Verantwortung übernehmen und an der Schöpfung mitwirken. Die sogenannte „Vertreibung“ aus dem Paradies ist somit keine Strafe, sondern der Beginn eines bewussten, verantwortlichen Lebens in der Welt. Raum ist hier nicht nur ein Ort des Geborgenseins, sondern auch ein Ort des Übergangs und der Reifung. Der biblische Garten ist ein Ort, an dem sich die Würde des Menschen konkretisiert – im Gleichgewicht von Freiheit und Verantwortung, Nähe und Distanz, Ordnung und Wachstum.

Bildungsarchitektur im Wandel
Auch in der Bildungsarchitektur ist ein Umdenken spürbar. Neue Schul- und Kindergartenbauten orientieren sich nicht mehr an der klassischen Korridor-Klassenraum-Logik, sondern setzen auf offene Lernlandschaften, vielfältige Raumnutzungen und flexible Gestaltung. Architekturpsychologische Studien belegen, dass solche Räume die Kommunikation fördern, Kreativität begünstigen und individuelles Lernen erleichtern. Vor allem aber laden sie dazu ein, Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. Die Architektur wird damit selbst Teil des pädagogischen Konzepts. Die Schule wandelt sich zu einer „Werkstatt“, in der verschiedenste Unterrichtsformen integriert werden können, von Stillarbeitsbereichen bis zu Zonen für Gruppenarbeiten.
Schulen werden zunehmend als Lebensräume konzipiert: mit Holz, Tageslicht, fließenden Übergängen zwischen Innen- und Außenraum. Verschiedene Schulkonzepte zeigen, wie Schulen ganz ohne herkömmliche Klassenräume auskommen und stattdessen offene Lernzonen für kooperatives Arbeiten und kurze Instruktionsphasen in flexiblen Einbauten bieten. Diese Ansätze fördern nicht nur den Gemeinschaftssinn, sondern auch die Inklusion, indem sie Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen mehr Bewegungsfreiheit und individuelle Betreuung ermöglichen, ohne sie vom Rest der Klasse zu isolieren.
Um eine flexible und individuellere Raumnutzung zu ermöglichen, haben sich verschiedene Organisationsmodelle etabliert: das Klassenraum-Plus-Modell, das herkömmliche Klassenzimmer um zusätzliche Flächen wie Rückzugsorte oder Gruppenräume ergänzt; das Cluster-Modell, bei dem mehrere Klassen einen Pool von Räumen nutzen, die flexibel kombiniert und getrennt werden können (wie es das Lern- und Teamhauskonzept vorsieht); und die Lernlandschaft, die völlig ohne Klassenzimmer auskommen kann. Die Verfügbarkeit von Wissen und die Möglichkeit der Zusammenarbeit über digitale Technologien dehnen die Definition von Lernräumen beliebig aus (3D-Drucker statt Computerraum), sodass auch Parks, Cafés oder das eigene Zuhause zu informellen Lernorten werden können. Und so ist ein wichtiger Bestandteil vieler neuer Bauten auch die Umgebung, indem zentrale Funktionsbereiche von Anwohnern oder Vereinen mitgenutzt werden können. Teamräume für Lehrkräfte sind natürlich genauso essenziell, um deren kollaboratives Arbeiten zu unterstützen.
Der Raum spricht. Und je mehr er sagt, desto bewusster müssen wir hinhören und mitgestalten. Gestaltung ist nicht Dekoration, sondern Ausdruck einer pädagogischen Grundhaltung. Die Einbindung aller Beteiligten in den Planungsprozess ist dabei entscheidend.
Der „Kindergarten“: Ein Wort, das eine Vision trägt
In der Elementarpädagogik haben wir für all das einen aussagekräftigen Begriff: „Kindergarten“. Friedrich Fröbel, der diesen Begriff im 19. Jahrhundert prägte, wollte damit bewusst an das Bild des Gartens anknüpfen. Für ihn war Erziehung keine Belehrung, sondern Pflege: So wie Pflanzen Licht, Wasser, Zeit und Zuwendung brauchen, brauchen auch Kinder einen Rahmen, in dem sie wachsen können – aus eigener Kraft, aber nicht sich selbst überlassen. Fröbel verstand den Kindergarten als einen Ort, an dem das kindliche Spiel und die Auseinandersetzung mit der Welt in einem geschützten, aber anregenden Umfeld stattfinden können. Er sah den Erzieher dabei nicht als Wissensvermittler, sondern als „Gärtner“, der die Bedingungen für optimales Wachstum schafft, ohne die Pflanze zu zwingen. Dies beinhaltet das Bereitstellen von vielfältigen Materialien, die zur Erkundung einladen, sowie das Schaffen einer Atmosphäre der Geborgenheit und des Vertrauens.
Diese ursprüngliche Vision Fröbels findet sich heute in vielfältigen Formen wieder, besonders, weil naheliegend, in der Elementarpädagogik. So verkörpern beispielsweise Wald- und Naturkindergärten die Idee des Gartens in ihrer reinsten Form, indem sie das Lernen und Spielen primär im Freien ermöglichen und die Natur als umfassenden Bildungsraum begreifen. Auch Einrichtungen, die sich stark an der Reggio-Pädagogik orientieren, legen großen Wert auf die Gestaltung des Raumes als „dritten Pädagogen“, indem sie offene Ateliers, vielfältige Materialien und flexible Lernbereiche schaffen, die die Kreativität und Eigeninitiative der Kinder anregen. Ebenso folgen viele Montessori-Kindergärten dem Prinzip der „vorbereiteten Umgebung“, die das Kind zur selbstständigen Erkundung und Entwicklung einlädt. Diese Beispiele zeigen, wie die Gartenmetapher in der frühkindlichen Bildung konkret umgesetzt wird und wie Räume bewusst als aktive Partner im Lernprozess gestaltet werden.
Der Kindergarten ist damit eine pädagogische Vision in einem einzigen Wort. Er erinnert uns daran, dass Räume, in denen Kinder aufwachsen, keine reinen Nutzflächen sind, sondern kulturell und spirituell bedeutsame Orte. Der Garten symbolisiert auch das Vertrauen in den inneren Bauplan des Kindes – in seine natürliche Entwicklung und seine intrinsische Motivation zu lernen. Nicht der Gärtner bringt die Pflanze zum Wachsen, sondern die Pflanze selbst – wenn die Bedingungen stimmen. Und diese Bedingungen betreffen eben auch den Raum, der als „dritter Pädagoge“ das Kind in seiner Entwicklung unterstützt und herausfordert.
Ein Garten in jedem Raum: Konkrete Impulse für den Alltag
Die Haltung des Gärtners beginnt bei den Pädagogen*innen selbst. Bevor sie Räume für das Wachstum anderer gestalten, gilt es zu reflektieren: Was brauchen sie selbst, um zu wachsen und ihre Rolle als Begleiter*innen optimal auszufüllen? Die Vision vom Garten lässt sich auch im Kleinen leben, indem Pädagogen*innen die Prinzipien des Gartens auf ihre eigene Arbeitsweise und die Gestaltung ihrer unmittelbaren Umgebung anwenden. Daraus erwächst eine authentische „Gärtner-Haltung“, die sich dann auf die Gestaltung der Lernräume für Kinder überträgt. Hier einige Impulse für Pädagogen*innen, um diese Haltung im Alltag zu entwickeln:
- Eigene Wachstumsräume pflegen: Pädagogen*innen schaffen für sich selbst bewusste Rückzugsorte und inspirierende Arbeitsbereiche – sei es ein aufgeräumter Schreibtisch, eine ruhige Ecke für Reflexion oder ein Raum für kreative Planung. Solche persönlichen „Gärten“ sind essenziell, um die eigene Energie zu pflegen und eine Haltung der Achtsamkeit zu entwickeln, die sich dann in der Gestaltung der Lernumgebung für Kinder widerspiegelt.
- Die Qualität der Werkzeuge wertschätzen: Wie ein Gärtner seine Werkzeuge sorgfältig wählt, achten Pädagogen*innen auf die Qualität und Beschaffenheit der Materialien, mit denen sie selbst arbeiten und die sie anbieten. Die Wertschätzung für natürliche Stoffe, ihre Haptik und ihre Authentizität, beginnt bei der eigenen Wahrnehmung und fließt dann in die bewusste Auswahl für die Kinder ein, um eine sinnliche und anregende Lernumgebung zu schaffen.
- Flexibilität in der eigenen Struktur leben: Pädagogen*innen entwickeln eine „Gärtner-Haltung“ zur Ordnung, die eine Balance zwischen notwendiger Struktur und Raum für spontanes Wachstum findet. Sie erkennen, dass zu starre Pläne die Entdeckerfreude hemmen können – auch ihre eigene. Diese innere Flexibilität erlaubt es ihnen, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und eine lebendige Atmosphäre zu schaffen, die nicht steril, sondern gepflegt-chaotisch wirkt.
- Die eigene Atmosphäre gestalten: Pädagogen*innen sind sich der Wirkung von Licht und Farben auf ihre eigene Stimmung und Konzentration bewusst. Sie nutzen diese Elemente gezielt, um ihre Arbeitsumgebung zu optimieren und eine positive Atmosphäre zu schaffen, die sie selbst stärkt. Diese Sensibilität für die räumliche Wirkung übertragen sie dann auf die Gestaltung der Lernräume, um eine motivierende und zugleich beruhigende Umgebung für alle zu schaffen.
- Gemeinschaftliche Gestaltung als Haltung: Pädagogen*innen erkennen den Wert der Partizipation nicht nur für die Kinder, sondern auch für ihre eigene professionelle Entwicklung. Sie sind bereit, Räume – sei es im Team oder mit den Kindern – gemeinsam zu gestalten und Ideen einzubringen. Diese kollaborative Haltung stärkt das Verantwortungsgefühl aller Beteiligten und lehrt, dass Bildung als gemeinschaftlicher Gestaltungsprozess verstanden werden kann.
Wer Räume bewusst gestaltet, gestaltet mehr als Möbel und Wände, nämlich Atmosphäre, Haltung, Beziehung. Pädagogen*innen, die den Raum als Garten verstehen, schaffen Orte, die Wachstum, Entfaltung und gelingendes Lernen ermöglichen. Der Garten Eden mag ein mythologischer Anfang sein – aber seine Botschaft ist real: Bildung braucht Räume, die wachsen lassen.
Kommentare
Sei der erste, der diesen Artikel kommentiert.






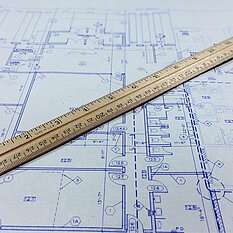
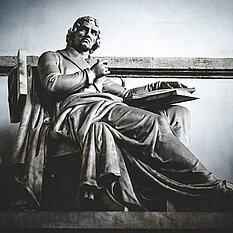

Kommentar schreiben
Bitte logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben.