
Jeder Konflikt kann eine Chance eröffnen
Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass ein Gespräch mit Menschen, die anderer Meinung sind, kaum mehr möglich ist? Die Fronten sind verhärtet: Entweder das Gespräch eskaliert schnell oder es wird von einer Seite abgebrochen oder von vornherein vermieden.
Das hat sicher viel mit der sogenannten „Bubble“ oder „Echokammer“ zu tun. Durch die sozialen Medien und deren Algorithmen werden uns Inhalte vorgeschlagen, die sich mit unseren Interessen decken und unser Mindset bestätigen. Aber auch im Privaten bzw. wenn wir es uns aussuchen können, umgeben wir uns lieber mit Menschen, mit denen wir uns „gut verstehen“.
Anders ist das oftmals innerhalb der (erweiterten) Familie, wo es dann häufig zu Spannungen während der Feiertage oder sonstiger Zusammenkünfte kommt. Hier prallen unterschiedliche Meinungen aufeinander und meist wird des lieben Friedens willen auf eine Konfrontation verzichtet. Das hinterlässt dann ein unbefriedigendes Gefühl und man ist froh, wenn sich die Wege wieder trennen.
Als Lehrperson ist die Situation eine vollkommen andere. Kaum eine soziale Gruppe ist so durchmischt wie eine Schulklasse. Abgesehen vom Alter sind mehr oder weniger alle Diversitätsdimensionen vertreten. Das bietet für die Lehrperson viele Herausforderungen, aber auch sehr viele Möglichkeiten, wie mit Unterschiedlichkeit umgegangen wird, damit die Kinder und Jugendlichen Erfahrungen sammeln, auf die sie im späteren Leben zurückgreifen können und in die Gesellschaft tragen. Lehrer*innen kommt dabei eine nicht zu unterschätzende Verantwortung zu.
Der Klassenraum ist ein Übungsort für Heranwachsende. Hier wird ausprobiert, Grenzen werden ausgelotet, Gruppendynamiken getestet, provoziert. Mit alldem sind Lehrer*innen konfrontiert und sollten nebenbei noch ihren Lehrplan einhalten.
So abgedroschen es klingt: Jeder Konflikt eröffnet die Chance, etwas Wesentliches zu lernen. Lehrpersonen haben dabei eine wichtige Vorbildfunktion. Oft werden im Unterricht Konflikte nicht ernst genommen oder ignoriert – zum einen, weil zu wenig Zeit ist, oder weil die Lehrperson nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. In der Gruppendynamik sagt man „Störungen haben Vorrang“1 – denn erst wenn der Konflikt behoben ist, steht wieder die Aufmerksamkeit fürs Lernen zur Verfügung.
Gesellschaftlich ist der Ton rauer geworden und das spiegelt sich auch in den Klassen wider. So sind Lehrkräfte häufig mit Aussagen oder Meinungen konfrontiert, die so noch vor ein paar Jahren vermutlich nicht geäußert worden wären. Wir erleben einen Backlash: Nach einer Zeit der political correctness sind abwertende Äußerung gegenüber Minderheiten, Randgruppen oder sexistische Bemerkungen wieder akzeptiert. Die Politiker und mächtige Männer (bewusst nicht gegendert) machen es uns vor. Doch wie wollen oder sollten wir damit umgehen?
Eine Möglichkeit, mehr Sicherheit im Umgang mit abwertenden und diskriminierenden Äußerungen zu bekommen, bietet ein Argumentationstraining gegen Stammtischparolen.
Klaus Peter Hufner – der Entwickler des Argumentationstrainings gegen Stammtischparolen – antwortet auf die Frage, was ihn ursprünglich zur Entwicklung seines Konzeptes motiviert habe: „Das ist eine lange Geschichte. Ich habe über viele Jahre hinweg politische Erwachsenenbildung an einer Volkshochschule organisiert und auch unterrichtet und versuchte immer wieder Veranstaltungen zu finden, die motivierend sind, freiwillig teilzunehmen. Das war mitunter ein sehr hartes, schwieriges Unternehmen. Dabei ist mir der Gedanke gekommen, man müsste doch etwas machen, was auch praktisch verwertbar ist: Selbstsicherheit, rhetorische Fähigkeiten … Und da kam die Idee, man könnte das mit politischer Bildung verbinden. Daneben gibt es auch meine eigene Vorgeschichte: Widerspruch gegen Rechtsextremisten war bei mir schon sehr früh angelegt. Daraus hat sich diese Idee entwickelt und irgendwann kam, wie ein heiterer Blitz aus dem Himmel, der Gedanke: Stammtischparole. Das war der Signalbegriff, der sich dann als Anker für die ganzen weiteren Entwicklungen dargestellt und als sehr erfolgreich gezeigt hat.“2

Was passiert in einem Argumentationstraining?
Definition des Begriffs Stammtischparole
Der Begriff der Stammtischparole ist im gesamten deutschsprachigen Raum verbreitet. Es handelt sich um Aussagen, die typischerweise am Stammtisch geäußert werden.
„Der Stammtisch versteht sich als Bollwerk des Soseins gegen das Anderssein. Man labt sich an Selbstvergewisserungen. Und zwar nicht nur an affirmativen, sondern an überaffirmativen. Konservativ bis reaktionär ist des Stammtischs Grundhaltung.“3
Dabei dienen die Parolen der Bestätigung der eigenen sozialen Gruppe und münden meist in der Abwertung anderer Gruppen zur eigenen Selbstaufwertung – heutzutage auch „othering“ genannt. Das schafft ein starkes Band zwischen Gleichgesinnten; Andersdenkende werden bereits von der schieren Übermacht zum Schweigen gebracht oder verbal niedergemacht. Man ist sich einig und duldet keinen Widerspruch. So die verkürzte Darstellung. Auch hierbei handelt es sich um weit verbreitete Stereotype. Welches Bild haben Sie im Kopf, wenn Sie an einen Stammtisch denken?
Der Begriff Stammtischparole ist deshalb auch nicht unumstritten, weil er Stereotype reproduziert und seinerseits eine Abwertung von Stammtischbesucher*innen impliziert. Hufner sagt dazu: „Der Begriff ist klar, aber Sie haben Recht, da steckt eine gewisse Verächtlichmachung drin. Aber andererseits kann man sich wieder retten: Nämlich die Verächtlichmachung wird dadurch relativiert, weil in diesen Stammtischparolen viel Verachtung herauskommt.“
Stammtischparolen werden definiert als rigide, ultimative Positionen, die voller Vorurteile sind, Schwarz-Weiß-Malerei, die kein Wenn-und-Aber zulassen, selbstgerecht daherkommen und in ihrer Rigidität auch keine Widersprüche akzeptieren.
Der Umgang mit Stammtischparolen ist schwierig, denn sie sind …
Nach der Klärung des Begriffs folgt ein Brainstorming dazu, was den Umgang mit Stammtischparolen schwierig macht. Dies dient sowohl dazu, den Begriff noch besser zu verstehen, als auch sich in Situationen hineinzuversetzen, in denen man Zeugin bzw. Zeuge solcher Parolen war. Und es macht deutlich, dass das kein individuelles Problem oder der schwierige Umgang damit im Unvermögen der Teilnehmenden zu suchen ist.
Welche Stammtischparolen kennt ihr?
Im nächsten Schritt werden wieder mittels Brainstorming Stammtischparolen gesammelt. Obwohl dieses Sammeln Stereotype reproduziert, ist es wichtig zu sehen, dass sie uns nicht fremd sind. Im Gegenteil – wir wachsen mit ihnen auf, sie umgeben uns und sind im täglichen Leben allgegenwärtig.
Die Gruppe wählt ihre „Lieblingsparolen“ aus, mit denen sie bei den Simulationen weiterarbeiten will.
Die Simulation
Die Simulation ist das Herzstück eines jeden Argumentationstrainings gegen Stammtischparolen. Hierbei wird eine Stammtischsituation nachgestellt. 3 Personen nehmen die Pro-Haltung ein und 3 Personen nehmen die Contra-Haltung ein. In 15 Minuten können die aktiven Teilnehmenden ausprobieren und fühlen, wie es ihnen in dieser Situation ergeht. Die übrigen Teilnehmenden beobachten das Geschehen. Nach der Simulation erfolgt eine umfassende Reflexionsrunde, in der auf die Dynamiken, den Redeanteil, die Aktivität oder Passivität, die Mimik und Gestik, die Gefühle der Protagonisten*innen eingegangen wird. Es wird gemeinsam untersucht, welche Strategien erfolgreich waren und welche weniger. Daraus folgt eine Sammlung an möglichen Strategien.
Je nach Zeitressourcen kann das Training um eine Recherche für gute Argumente gegen Stammtischparolen, mit denen die Teilnehmenden öfter konfrontiert sind, und eine weitere Simulation ergänzt werden. Ein Input zum Thema Stereotypen und Vorurteile sollte nicht fehlen.
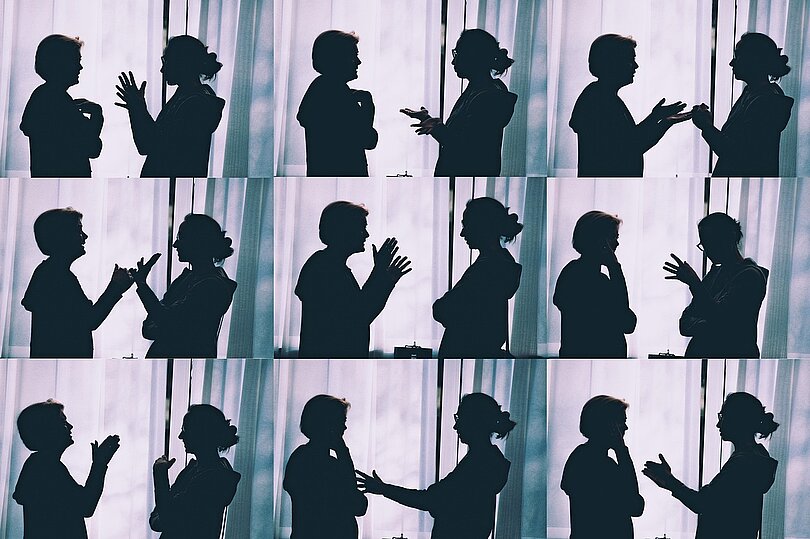
Resümee
Nach dem Training sind die Teilnehmenden gestärkt, in künftigen schwierigen Situationen besser reagieren zu können. Mit den vielen gesammelten Gegenstrategien haben sie in Zukunft einen größeren Handlungsspielraum. Durch das Erleben der Gruppendynamik ist verständlich geworden, wie leicht und oft auch lustvoll es ist, mit Stammtischparolen zu provozieren. Manchmal kann das dazu beitragen, solche Konfrontationen, auch wenn es um ernste Themen geht, nicht ganz so ernst zu nehmen und eine gewisse Leichtigkeit beizubehalten. Gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, dass bei populistischen oder abwertenden Parolen ein Ignorieren meist als Zustimmung fehlinterpretiert wird. Das bedeutet, das Mindeste, was wir tun sollten, selbst wenn uns dazu manches Mal die Energie fehlt, ist, klare Haltung zu zeigen und wenn wir nur sagen: „Ich sehe das nicht so!“ oder „Das war jetzt sehr sexistisch!“
(...) und wenn wir nur sagen: „Ich sehe das nicht so!“
Das Argumentationstraining gegen Stammtischparolen bietet kein „Patentrezept“ – keine allzeit gültigen Strategien und Lösungen für jede Situation, es trainiert auch nicht direkt die Schlagfertigkeit. Allerdings werden die Teilnehmenden dazu empowert, zukünftig ihren eigenen authentischen Weg zu gehen, mutig zu sein und bewusste Entscheidungen zu treffen.
Literaturhinweise
1 de.wikipedia.org/wiki/Themenzentrierte_Interaktion
2 Die Handreichung lässt zahlreiche Experten*innen zu Wort kommen, die in der Recherche zur Entwicklung von Qualitätsstandards für Argumentationstrainings gegen Stammtischparolen befragt wurden. www.argumentationstraining-gegen-stammtischparolen.de/handreichung
3 www.derstandard.at/story/3000000199804/der-stammtisch-als-rueckzugsort-und-hort-reaktionaerer-gesinnung
Kommentare
Sei der erste, der diesen Artikel kommentiert.





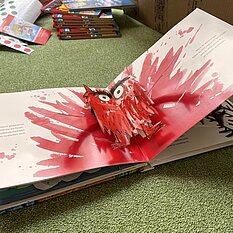


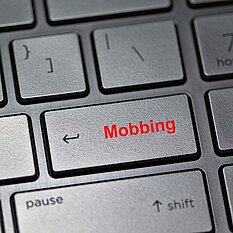
Kommentar schreiben
Bitte logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben.