
Eva Niederegger: Vor einiger Zeit habe ich eines Ihrer Bücher auf einer Tagung am Ausstellungstisch liegen sehen. Ich habe es gekauft, gelesen, verliehen, weiterempfohlen, verschenkt. Warum? Weil es mir beim Lesen so viele Aha-Momente geschenkt hat und ich nicht drumherum gekommen bin, mir immer wieder für mich Bedeutsames mit der altbekannten Methode der Eselsohren zu kennzeichnen. „Zuversicht - Die Kraft der inneren Freiheit und warum sie heute wichtiger ist denn je“, so der Titel. Im letzten Kapitel Ihres Buches schenken Sie den Leserinnen und Lesern ein Resümee: Diezuversichtlichen Zehn. Im September beginnt das neue Kindergarten- und Schuljahr. Welche zwei oder drei Sofortmaßnahmen empfehlen Sie Pädagoginnen und Pädagogen als Erste-Hilfe-Programm, wenn es wieder schwierig wird?
Ulrich Schnabel: Erstens: Shit happens. Wo Menschen zusammenkommen, gibt es auch Probleme. Es hilft, sich das klarzumachen. Das bringt zwar die Probleme nicht zum Verschwinden, aber man ärgert sich weniger - und ann konstruktiver handeln. Zweitens: Halten Sie Ausschau nach Verbündeten. Wer Probleme gemeinsam angeht, hat es leichter. Oft hilft auch schon das Reden darüber, vielleicht schafft man es sogar, gemeinsam darüber zu lachen - dann sieht die Sache gleich anders aus. Denn es ist immer gut, drittens, den Blick zu weiten. In der Regel fokussieren wir uns vor allem auf Defizite und Schwierigkeiten; was dagegen gut läuft und positiv ist, blenden wir schnell als selbstverständlich aus. Arbeiten Sie aktiv gegen diese „Negativverzerrung“ und rufen Sie sich zum Beispiel abends auch die Dinge in Erinnerung, die heute schön waren. Sie werden merken: Probleme sind nicht alles.
Wer Probleme gemeinsam angeht, hat es leichter. Oft hilft auch schon das Reden darüber ...
Eva Niederegger: Und was hat es mit der Strategie der glorreichen Fünf auf sich?
Ulrich Schnabel: Die hilft, schwierige Situationen zu bewältigen. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie starten zum Familienausflug und auf der Autobahn setzt plötzlich der Motor aus. Sie kommen auf dem Standstreifen zum Haten, die Kinder jammern, der Partner meckert und die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Was tun? Da helfen die
glorreichen Fünf.
- Erstens: Gefühle rauslassen! Beißen Sie vor Wut ins Lenkrad oder treten Sie gegen einen Reifen - aber lassen Sie Ihren Ärger nicht an den Anderen aus. Wenn die Wut allmählich verraucht, kommt
- Schritt zwei: Sagen Sie: Das gehört dazu. Natürlich ist eine Panne ärgerlich. Aber das Unvorhergesehene ist Teil des Lebens. In dem Moment, in dem man das anerkennen kann, kommt man aus der Opferrolle heraus. Das ist die Voraussetzung für
- Schritt drei: Betrachten Sie die Sache als Trainingseinheit. Wie kann ich mit unangenehmen Situationen und Widrigkeiten umgehen? Aus dem Ärgernis wird eine Möglichkeit, daran zu wachsen.
- Nun sind Sie bereit für Schritt vier: Lösungen suchen. Eine findet man meist schnell, aber aktivieren Sie Ihre Kreativität und überlegen Sie sich acht Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen. Bei einer Autopanne reicht es, den Abschleppwagen anzurufen. Aber in komplexeren Situationen - etwa bei Streit in der Ehe oder in der Arbeit - ist es hilfreich, nicht dem erstbesten Reflex zu folgen („Ich gehe!“), sondern sich mehr Optionen zu überlegen, die weiter führen.
- Dann folgt Schritt fünf: Entscheiden Sie sich. Selbst wenn keine Option perfekt sein mag, ist es besser, eine Entscheidung zu treffen als keine. Tun Sie das, was Ihnen unter den gegebenen Umständen als das Beste erscheint. Und wenn sich später neue Fakten ergeben, revidieren Sie eben die Entscheidung.

Eva Niederegger: Als heuriger Gast der Pädagogischen Großtagung der Verbände KSL und ASM haben Sie ein
aktuelles Thema mitgebracht: „Wie wir soziale Intelligenz fördern“. Unsere größte Stärke, so sagen Sie, ist die Fä-
higkeit, uns in andere hineinzudenken, mit ihnen zu kommunizieren und gemeinsam zu handeln. Wie können wir
diese Fähigkeiten bei Kindern fördern?
Ulrich Schnabel: Indem man sie vorlebt. Gerade weil wir alle sozial intelligent sind, merken wir sehr schnell, ob sich ein Gegenüber authentisch verhält oder nicht. Wenn mir jemand einen langen Vortrag über gutes Kommunizieren oder gemeinsames Handeln hält, am Ende aber letztlich nur seinen Willen durchdrücken will, dann ist das kontraproduktiv. Zum guten Kommunizieren gehört auch das Zuhören, zur Gemeinsamkeit auch die Anerkennung, dass die Anderen nicht unbedingt meiner Meinung sind. Deshalb bedeutet „Soziale Intelligenz“ nicht, dass in einer Gruppe eitel Harmonie herrscht, sondern dass wir in der Lage sind, mit Konflikten klug umzugehen und Lösungen zu finden.
Eva Niederegger: Und für ein gutes Miteinander unter den Pädagoginnen und Pädagogen? Was könnte helfen, mögliche Spannungen abzubauen?
Ulrich Schnabel: Nicht im Affekt reagieren! Oft hilft es schon, einmal durchzuatmen, sich innerlich eine kleine Auszeit zu nehmen, bis die Emotionen etwas abgekühlt sind - siehe die glorreichen Fünf. Sonst schaukelt sich ein Konflikt so lange auf, bis man sich am Ende Dinge an den Kopf wirft, die ein Arbeitsverhältnis nachhaltig beschädigen können. Besser ist es, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation zu agieren. Wenn man merkt, dass einem dazu gerade die Ruhe fehlt, dann kann man die Sache auch vertagen und sagen: Darüber muss ich erstmal nachdenken. Und natürlich ist es immer gut, sich mit Menschen zu beraten, die selbst nicht involviert sind und inen Konflikt unvoreingenommen beurteilen können.

Eva Niederegger: Sie persönlich? Wie kultivieren Sie soziale Intelligenz?
Ulrich Schnabel: Indem ich täglich übe, meine Tipps zu beherzigen und die Reflexe und Gewohnheiten zu durchschauen, die der sozialen Intelligenz entgegenstehen. Etwa die Überzeugung, dass wir selbst doch immer nur in der besten Absicht handeln und an Konflikten deshalb stets Andere Schuld haben. Zum Glück habe ich eine kluge Frau, die mir als Korrektiv dient. Denn nur in Beziehung zu anderen wird man wirklich sozial intelligent.
Eva Niederegger: Unser Leitthema im KSL heißt Gemeinsam gestalten - in die Zukunft begleiten“. Eines unserer Anliegen seit der Gründung des Verbandes ist es, tragende Netzwerke untereinander zu spannen. Mit einer werte- und zukunftsorientierten Haltung wollen wir Kolleginnen und Kollegen in den Schulen und Kindergärten in ihrer pädagogischen Persönlichkeit unterstützen. In Ihrem Buch „Zusammen“ plädieren Sie für die Wiederentdeckung des Gemeinsinns. Ist er uns verloren gegangen?
Ulrich Schnabel: Ich glaube, er ist aus dem Blick geraten. In vielen Bereichen, angefangen von der Schule, über Sportvereine oder soziale Medien bis hin zur Arbeitswelt, dominiert heute eine Atmosphäre des Wettbewerbs und der Konkurrenz. Überall gilt es, gute Leistungen zu erbringen, das Beste aus seinem Typ zu machen und sich selbst in möglichst positivem Licht zu präsentieren. Dass wir die allermeisten Herausforderungen nur mit Hilfe Anderer bewältigen können, wird dagegen selten thematisiert. Dabei wären wir - auf uns allein gestellt - noch nicht einmal in der Lage, eine Tasse Kaffee zu trinken. Denn dafür braucht es Kaffeebauern, pflücker*innen, -transporteure*innen, -versicherer, -röster*innen, -verkäufer*innen und viele mehr. Wenn man es sich genau überlegt, ist an unserem Kaffee die halbe Welt beteiligt. Sich das klarzumachen, bedeutet für mich Gemeinsinn.
Überall gilt es, gute Leistungen zu erbringen, das Beste aus seinem Typ zu machen und sich selbst in möglichst positivem Licht zu präsentieren.

Eva Niederegger: Als Allzweckpflaster für alle Fälle empfehlen Sie Humor. Ein Witz zum Abschluss?
Ulrich Schnabel: Der Lehrer fragt: "Was ist der Unterschied zwischen Unwissen und Desinteresse?"
Antwortet der Schüler: "Keine Ahnung - und ist mir total egal!".
Oder wenn Sie lieber Kinderhumor wollen: Wonach riecht es in der Villa Kunterbunt? – – – Nach Pippi.
Eva Niederegger: (lacht) Soll ich auch einen erzählen?
Ulrich Schnabel: Klar, gerne.
Eva Niederegger:
Paul: „Ich will nicht zur Schule gehen!“
Mutter: „Du musst aber.“
Paul: „Nenne mir zwei Gründe!“
Mutter: „Du bist 45 Jahre alt und der Schuldirektor.“
Ulrich Schnabel: (lacht) Ja, das passt zum Anfang: Wo Menschen zusammenkommen, gibt es auch Probleme. Und wenn man darüber lachen kann, sieht die Lage gleich anders aus.
Eva Niederegger: Herzlichen Dank, bleiben wir im Dialog…
Kommentare
Sei der erste, der diesen Artikel kommentiert.









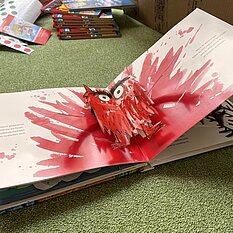
Kommentar schreiben
Bitte logge dich ein, um einen Kommentar zu schreiben.